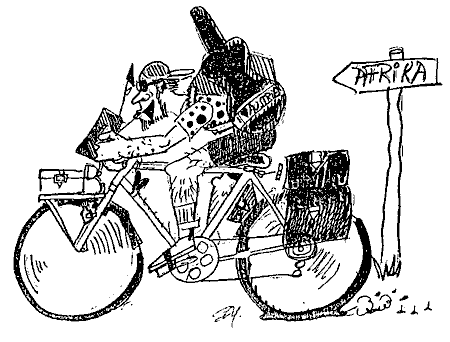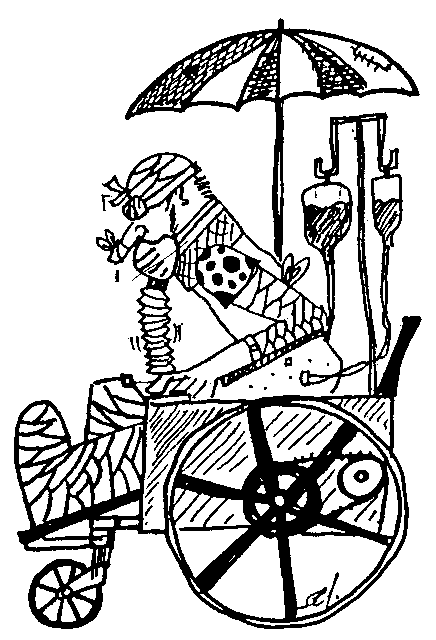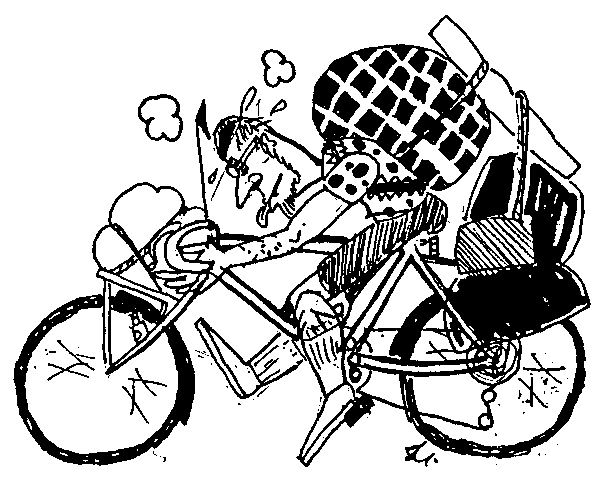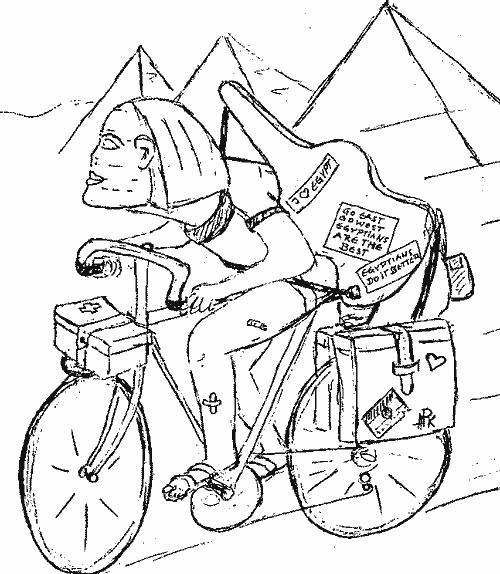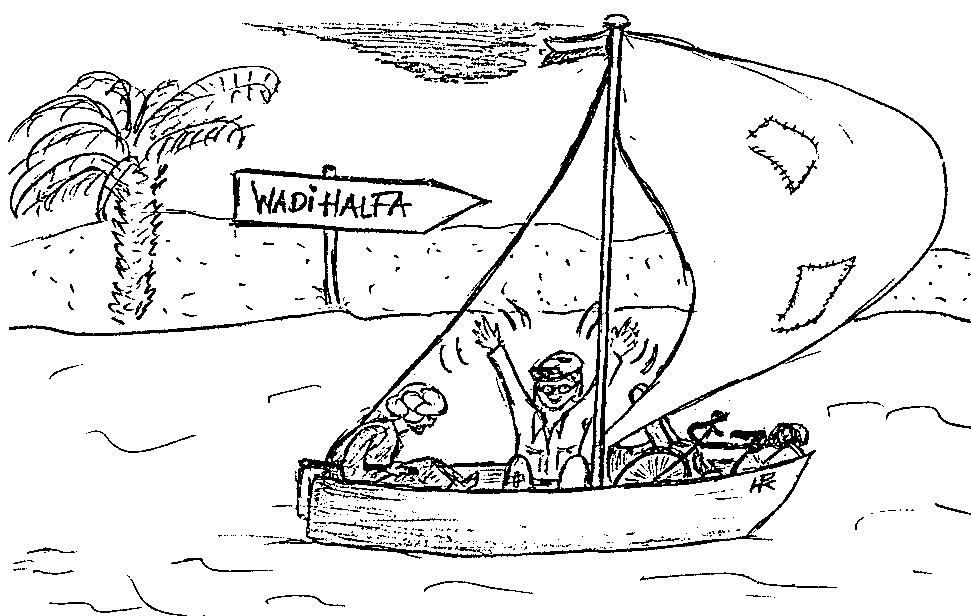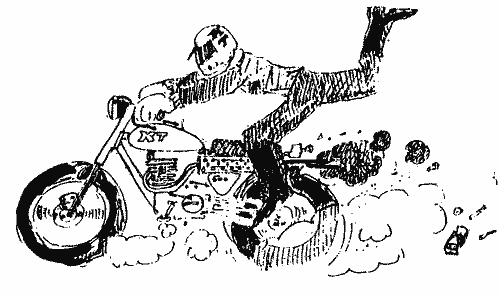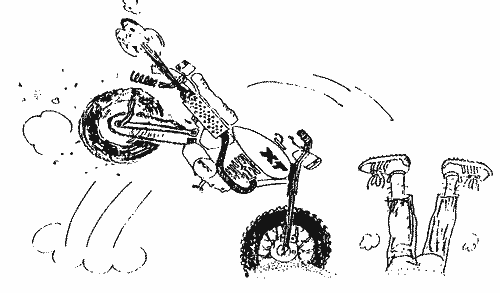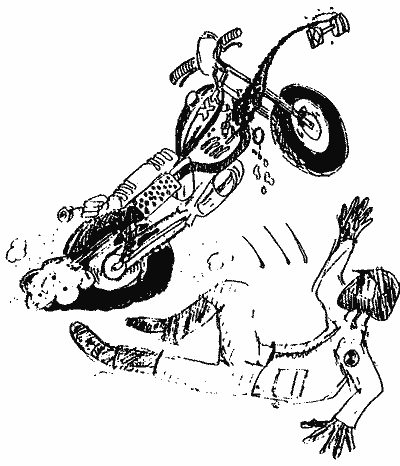Touren
Inhalt:
Felukkafahrt von Assuan nach Luxor
Schritte in dunkler Nacht
Von Dakhla nach Farafra – 112 Jahre "nachgewandert"
Von Kairo nach Abu Simbel
Mit Kamelen in die Wüste – Portrait eines Kölners: Dr. Carlo Bergmann
Bahn-Trekking (von Genf nach Kairo)
Fahrradtour nach... Afrika
Pharaonen-Rallye – Ein Fluch der Pharaonen
Cross-Sahara – der etwas andere Reisebericht
![]()
![]()
![]()
Fahrradtour nach, in und durch Afrika
von Hartmut Fiebig
in 6 Folgen
Folge 1 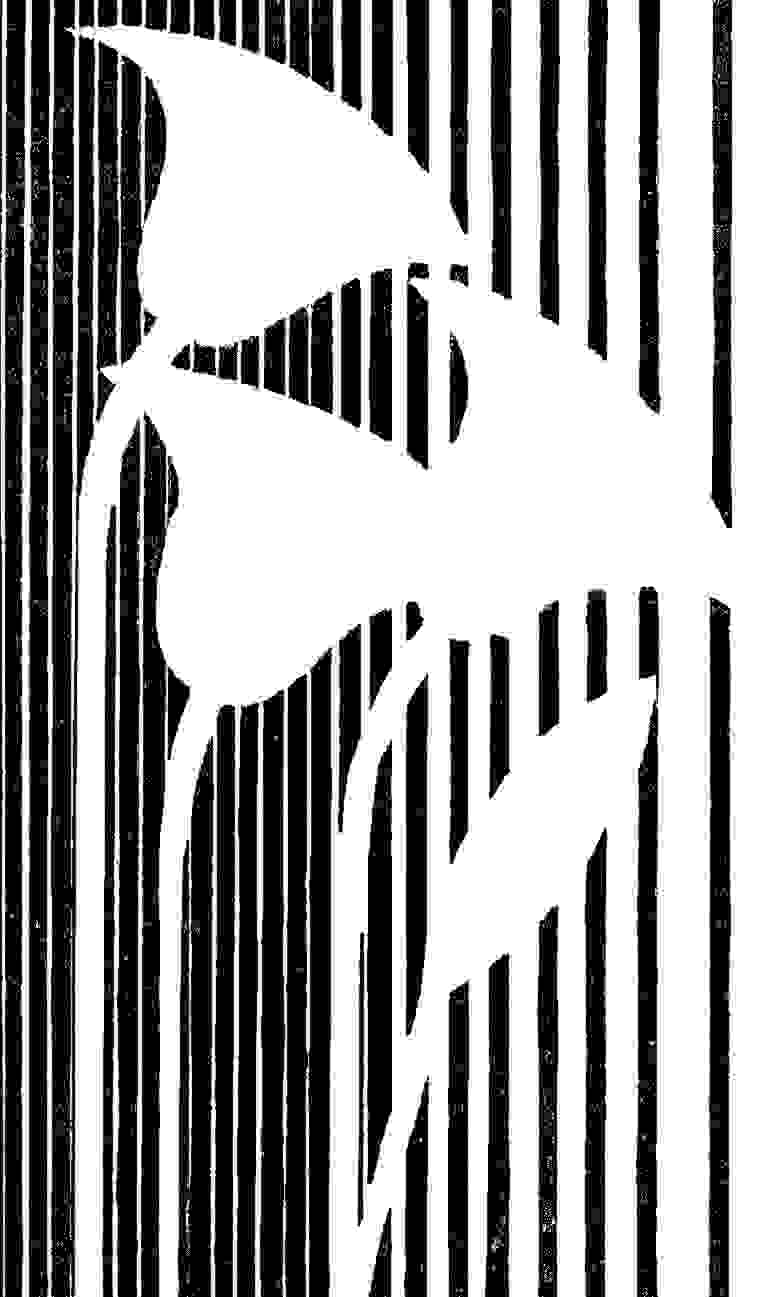 Nr. 3/90, pp. 61—63
Nr. 3/90, pp. 61—63
Mit der Ankunft in Ägypten ist das Tor nach Afrika aufgestoßen. Fast auf den Tag genau drei Monate ist es nun her, daß ich vom Bodensee aus zu einer Fahrradtour durch Afrika, einem langjährigen Traum, aufbrach.
Kurz hinter Rosenheim in einem dieser kleinen bayerischen Dörfchen am Fuße der hier mächtig aufragenden Alpen bestaunt mich ungeniert ein sommersprossiger Stupps mit seinem alten Bonanzarad, wie ich genüßlich meine Brotzeit halte. Neugierig, wie seine abstehenden Ohren, fragt er mich mit seinem mir schwer verständlichen Dialekt nach dem woher und wohin. Auf die prompte Antwort "Ägypten!" reagiert er mit beifälligem Nicken in nordwestlicher Richtung und so füge ich erläuternd hinzu: "Das ist noch weiter als Österreich!" Doch sein Interesse gilt längst anderen Dingen. Mit dem geschenkten WWF-Aufkleber verziert er sein eigenes Stahlroß, um danach, auf mein freundliches Angebot hin, vollmundig an meiner Wustsemmel zu partizipieren.
Österreich, von Salzburg bis Wien, versinkt um mich in den kühlen, grauen Schleiern der trächtigen Wolkenherden, die beständig nach Osten ziehen, getrieben von einem unfreundlichen Westwind; und so fasse ich mir frierend am Wiener Westbahnhof ein Herz und rufe die Großmutter eines Freundes an. Eine halbe Stunde später sitze ich bei "Oma" im XIX. Bezirk in der warmen Stube und werde mit dampfenden Köstlichkeiten nach Strich und Faden verwöhnt.
Das Wetter hat sich gebessert, als ich am Seewinkelhof, dem WWF-Informationszentrum an der Langen Lacke eintreffe.
Emanuel, ein Wiener Crack-Ornithologe, verschafft mir den Genuß einer Privatführung durch das international bekannte Vogelschutzgebiet nahe dem Neusiedler See, und bald wird mir vor lauter "Rotschenkeln", "Grünschenkeln", und wie die anderen langbeinigen Wattvogelschönheiten noch heißen, ganz schwach zumute.
Zu Budapest, der wunderschönen Metropole einstiger Donaumonarchien, wo die Pracht und der Glanz vergangener Jahrhunderte unter der staubigen Patina der letzten 70 Jahre hervorscheint, finde ich ein Musikgeschäft mit erschwinglichen Gitarren, und so mache ich mich eine halbe Stunde vor Ladenschluß auf, die erforderliche Summe auf dem Schwarzmarkt zu tauschen. Nach zwei Versuchen, mich auf der Straße beim Wechseln übers Ohr zu hauen, ist die Gitarre vergessen, in mir wächst das Verlangen, von diesen hehren Brüdern einige interessante Tips für die eigene Trickkiste abzustauben, doch das Repertoire ist enttäuschend mager! Wichtige Voraussetzung für das Gelingen dieser Gaunerstückchen ist, dem Touristen einen Teil seiner Aufmerksamkeit zu nehmen. Der Wechsler hat bereits vor dem Handel zwei Geldpacken vorbereitet; der erste, mit der vereinbarten Summe, liegt auf seinem Portemonnaie, der andere, er gleicht dem Original äußerlich genau, enthält jedoch lediglich kleine, wertlose Scheine, wird unter der Börse gehalten. Dem Kunden wird die korrekte Summe vorgezählt – da greift ein Komplize, "der Polizist" in Zivil ins Geschehen ein und lenkt den Kunden für den Bruchteil einer Sekunde ab, der ausreicht, mit einer geschickten Wendung des Portemonnaies das falsche Päckchen unbemerkt nach oben zu drehen. Angesichts der drohenden "Gefahr" besiegelt man hastig die Transaktion und verschwindet auf Nimmerwiedersehen im Gewühle.
|
Jugoslawien: das Land, wo Gastwirte einem radfahrenden Studenten das Abendessen spendieren, wo die Polizei auf dem Autoput (für Radler verboten!) grüßend die Hand an den Mützenschirm legt, wo mir die ersten Minarette begegnen und wo die Schönheiten der Landschaft der Freundlichkeit der Bevölkerung fast ebenbürtig sind...
Bei Priština werde ich von einer Geschwindigkeitskontrolle energisch herausgewunken, doch stammelnd Besserung gelobend läßt man mich augenzwinkernd meiner Wege ziehen. Zu Skopje, der Hauptstadt des jugoslawischen Teils Makedoniens, erstehe ich doch eine Gitarre, am Zoll aber rutscht mir dann das Herz in die Hose, als der jugoslawische Zöllner mit strengem, prüfendem Blick das nagelneue Instrument einfordert – seine nächste Frage wird die nach der Umtauschbescheinigung sein, die ich jedoch nicht besitze. Doch es kommt anders: der Beamte schiebt die Mütze in den Nacken, schlägt die Beine übereinander und beginnt, vorsichtig erst, einige Akkorde zu zupfen. Ich erkenne sofort "Hotel California", und so stehen wir beide im Licht der untergehenden Sonne an der Abfertigung, er malträtiert das Instrument, und ich schmettere, was das Zeug hält. Es folgt "Stand by me", und auch das aufkommende Geschimpfe der wartenden Reisenden in unserem Rücken kann uns nicht davon abhalten, den Gig mit einem Beatles-Klassiker würdevoll zu beenden – das ist Völkerverständigung! Beswingt passiere ich auch die griechischen Zollformalitäten.
Griechenland zeigt uns ein neues, sein schönstes Gesicht: der touristisch "unterentwickelte" Norden überrascht mich mit herzlicher Gastfreundschaft und malerischen Dörfchen in urtümlicher Landschaft. Lediglich meine alte Abneigung gegenüber Thessaloniki erfährt eine weitere Bestärkung: zwei Tage warte ich hier auf Post von zuhause, in einer Stadt, die zur Hälfte aus Tankstellen, Reparaturwerkstätten und Autohäusern zu bestehen scheint und die im übrigen den wenig erbaulichen Eindruck hinterläßt, die von einem bizarren Wald aus Fernsehantennen bestandenen Gebäude harrten noch ihrer Fertigstellung ...
"Die Straße von der griechisch-türkischen Grenze nach Istanbul ist ein echter Hammer", warnte mich ein deutsches Radlerpärchen, das mir kurz vor dem Schlagbaum begegnete.
Ein PKW folgt dem anderen, zumeist mit deutschem Kennzeichen, es sind die Gastarbeiterfamilien, die mit dem Ferienende nach Deutschland zurückkehren. Und obwohl sie bei ihren halsbrecherischen Überholmanövern wie Geschosse an mir vorüberzischen, fürchte ich in erster Linie den Schwerverkehr, die Busse und LKWs. Ihre dichten Dieselschwaden legen die Straße unter einen schmutzig-grauen Schleier und schnüren mir den Hals zu, doch mein Körper verlangt nach nichts sehnlicher als nach Sauerstoff bei der Schwerstarbeit, die er in seinem Kampf gegen Steigungen und den stürmischen Gegenwind zu leisten hat. Wie eine mächtige, unsichtbare Faust packt und schüttelt mich die Druckwelle jeden Gegenverkehrs und preßt mich unerbittlich, gerade bin ich wieder in Fahrt, zum Stillstand zurück. Ein unheilvolles Pfeifen vermag mich noch eben rechtzeitig zu warnen, panisch drücke ich mich an den äußersten Fahrbahnrand, dann taumle ich in dem Sog eines überholenden LKWs, und bei dem Versuch gegenzusteuern, krache ich ein zweites Mal auf das 20 cm tiefere Baubett aus Kies- und Glassplittern. Zittern und fluchend vor ohnmächtiger Wut hebe ich das Rad wieder auf die Straße, verbissen stemme ich mich in meiner Verzweiflung erneut in die Pedalen, der Wind pfeift schadenfroh mit doppelter Stärke durch die Speichen. Die humorvollen unter den Lastwagenfahrern – und die Türken besitzen bekanntlich eine sehr lustige Volksseele – lassen ihre apokalyptischen Hörner – Josuas Posaunen müssen Engelszungen dagegen sein – erst erschallen, wenn sie direkt hinter mir oder noch besser: unmittelbar neben mir sind. Mit abrupten Sätzen und panischen Schlenkern belohne ich diese Nummern. Ich bin ein einziges Nervenbündel, ein schmutziges, von einem schleimigen Film aus Ruß, Staub und Schweiß überzogenes, dazu! Ich wünsche sämtlichen Kraftfahrern Achsenbruch und Totalschaden am Chassis, allein: vergeblich! Einziger Lichtblick: die Scharen von Weißstörchen, die parallel zur Straße mit mir in Richtung Afrika ziehen.
Zum Seitenbeginn
Zum PapyrusArchiv
![]()
![]()
Folge 2 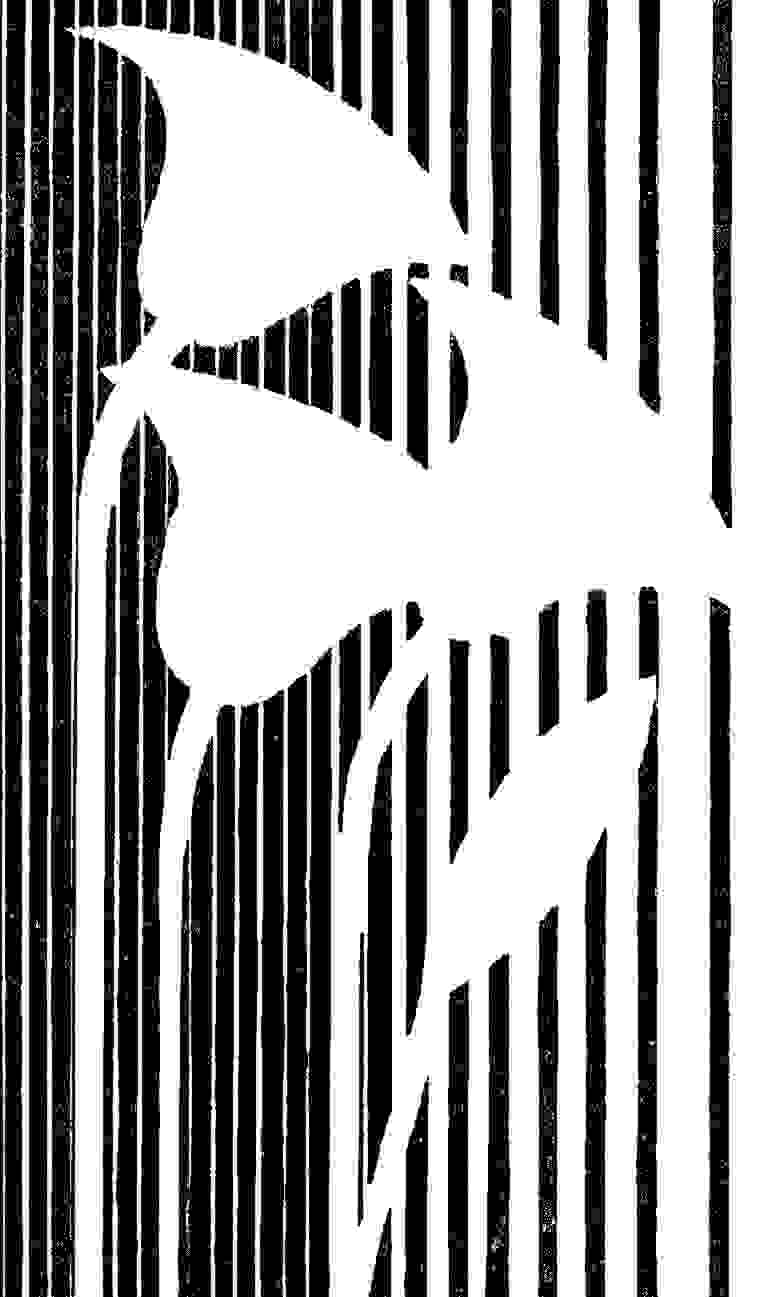 Nr. 4/90, pp. 77—79
Nr. 4/90, pp. 77—79
Jetzt gilt's: zum Frühstück will ich am Bosporus sein, noch üppige 90 km der Qual liegen vor mir, als ich um 3 Uhr früh in den Sattel steige. Ich erreiche rechtzeitig die Vorstädte Istanbuls, um mich einzureihen in die allmorgendliche Massenprozession der Pendler Richtung Stadtmitte und dem Schmutz ihrer Fahrzeuge.
Die Vorsehung mag meine Schritte gelenkt haben, denn im unübersehbaren Gewimmel der Sträßchen und Gäßchen öffnet sich mir plötzlich die marmorne Pforte zur paradiesisch kühlen Vorhalle eines türkischen Bades, eines Hammam. Ich erblicke lediglich mit einem Handtuch bekleidete, um einen kleinen Springbrunnen sitzende Männer, teetrinkend und redend im einschläfernd sanften Licht der durchbrochenen Deckenkuppel – ein Bild der Ruhe. Freundlich wird mir von der Herrenrunde bedeutet, ich möge doch eintreten, und ein geflissentlicher Alter führt mich in die Umkleidekabine. Als ich das Atrium wieder betrete, umhüllen auch mich die schlichten Leinentücher. Ein fleischiger Bulle erhebt sich behende und fragt in unverfänglichem Ton: "Massage?" Meine Zustimmung ist arglos und promt. Etwas hilflos folge ich der massigen Gestalt über die kalten Marmorfliesen durch die Fluchten und wärmer werdenden Hallen, die sich, dem Gesetz jahrhundertelanger Erfahrung folgend, aneinanderreihen, ins Herz des Bades, einem runden, nebelverhangenen Bau, in dessen Hitze triefende Leiber auf Marmorbänken hängen, im eigenen Saft schmorend. Auch ich bin noch nicht ganz reif und soll erst – so wird mir bedeutet, eine Viertelstunde aufweichen, bis dann die Massage ihren Lauf nimmt. Wer ist Herr und wer ist Diener? Gefügiges Wachs bin ich unter den breiten Händen des Masseurs, die jetzt bestätigen, was ich vorher bereits ahnte: geschmeidige Muskeln spielen unter der fetten Haut, wenn die mächtigen Pranken quatschend über die Schmiere aus Schweiß, Ruß und Dreck gleiten, die sich auf meinem Körper verteilt. Kundig läßt er jeden einzelnen meiner Wirbel knacken, indem er sein beachtliches Lebendgewicht mittels der Hände auf die Wirbelsäule preßt, daß mir schier die Luft wegbleibt. Ich leiste keinen Widerstand mehr gegen sein Trommeln und Recken, Schlagen und Zerren, Pressen und Klatschen, Kneten und Walken. Die Spannung der letzten Tage – besonders der abschließenden, nächtlichen Gewalttour – wird mir regelrecht aus dem Körper getrieben. Die bestechende Technik dieser formidablen Massage besteht darin, den Körper in der feuchten Hitze anzulösen, ihn dann sorgfältig in seine einzelnen Glieder zu zerlegen, um ihn schließlich, besser dann, einem Baukasten gleich, aufs Neue zusammenzufügen.
Anschließend werde ich in den kühleren Vorraum geführt und in einem der zahlreichen Kabuffs auf die Bodenkacheln gedrückt. Kaskaden klaren Wassers, lauwarm zuerst, doch dann immer kühler werdend, schickt er Meister über die erhitzte, aufgeschwemmte Haut. Donnernd schlagen die rauhen Lederhandschuhe aufeinander, daß es im kahlen, hohen Raum nur so schallt. Auftakt zu einem Rubbelfortissimo, dem ich vibrierend unterliege. In dicken, braunen Flocken lösen sich Schmutz, Fett und Haut vom Körper, ich werde richtiggehend geschält, und es schimmert wieder appetitlich rosa, wo ich vorher stolz falschen Teint präsentierte. Das Grobe, so sollte man meinen, sei nun runter, doch beißende Kernseife vermag eine weitere Schicht zu lösen...
Kunstvoll werde ich dann abschließend in einem Berg Handtücher verpackt, endgültig ein willenloses Paket. Doch als ich am Springbrunnen abgesetzt worden bin, merke ich in mir eine geläuterte Lebensfreude aufsteigen, die zart den Handtüchern entsprießt, und ich vermag schon wieder mit Humor zu rekonstruieren, was da vorhin über mich hereingebrochen ist. War mir vorhin die Haut vom Leibe gerissen worden, so wird mir jetzt noch das Fell über die Ohren gezogen, doch mein Wille ist gebrochen und ohne Widerspruch gebe ich das reichlich geforderte Bakschisch ... ich bin im Orient!!!
|
50 km hinter Istanbul werde ich doch noch zum Opfer der katastrophalen türkischen Verkehrsverhältnisse: nach der Kollision mit einem LKW werde ich bewußtlos ins Krankenhaus eingeliefert, wo ich mit Gehirnerschütterung, schweren Schürfwunden und Prellungen zwei Wochen gepflegt werde. Zwar vermag ich mich an den genauen Unfallhergang nicht zu erinnern, da an entsprechender Stelle mein Gedächtnis eine gnädige Lücke zeigt, doch erfordert es keine überdurchschnittlichen Fähigkeiten bei meinem reichen Erfahrungsschatz an Beinahe-Zusammenstößen auf türkischen Straßen, das Geschehen realistisch zu rekonstruieren, und so danke ich Gott, nicht ein unschöner Matschfleck an der E 5 zwischen Instanbul und Ankara geworden zu sein, ja, ich habe immenses "Glück" gehabt!
Meine Reiselust hat durch den Unfall lediglich einen vorübergehenden Dämpfer erlitten, doch die Quetschungen und Blutergüsse in beiden Knien zwingen mich, nach vier Tagen der Qual 60 km vor Ankara zur Aufgabe: es geht noch nicht! Resigniert lasse ich mich auf einen Tomatenlaster verladen, der mich bis nach Adana an der Südküste mitzunehmen bereit ist. Die Fahrt in der engen Fahrerkabine wird zur längsten Nacht meiner bisherigen Reise: die angewinkelten Knie schmerzen, in meinem Bauch tobt eine furchtbare Amöbenschlacht, ich habe Fieber, vom Zug im Fahrerhaus habe ich einen steifen Hals und meinen Rücken peinigen seit langem wieder Verspannungen. Heulen möchte ich, anstatt dessen möchte der Fahrer wachgehalten werden und erwartet heitere Konversation...
Mit dem Bummelzug gelange ich schließlich nach Iskenderun, wo ich auf dem beschaulichen Campingplatz für eine Woche meine Zelte aufschlage. Episodisch nur wird in dieser Zeit von anderen Touristen meine friedliche Koexistenz mit dem Campingplatz-Personal gestört, mit dem ich allabendlich palavernd den Çai genieße.
Ein Bus libanesischer Schulkinder, der nach einem Monat Urlaub vom Töten in die bürgerkriegszerstörte Heimat zurückkehrt, eine persische Teppichhändler-Familie, die mich zum Abendessen einlädt, ein österreichischer Motorradfahrer, mit dem ich Reiseerlebnisse und -erfahrungen austausche, und einer der knallroten Rotel-Busse mit Schlafanhänger erscheinen als Zaungäste dieser Idylle.
Andächtig lausche ich den Problemen, Zwistigkeiten und Sticheleien der "Mumien-Expreß"-Touristen, im stillen die Vorzüge der Einzelreise preisend. Die manchmal von mir als fehlend empfundene Reisegesellschaft wird hier freilich im Übermaß geboten. Doch einzeln genommen sind sie alle schon sehr lieb. Brav erzähle ich meine rührenden Reiseerlebnisse und -pläne, worauf ich mit deutscher Wurst und Erdnußkeksen beschenkt werde. Gott vergelt's! Auch wird mir hier lieberweise eine sichere Kuriergelegenheit für einen Teil meiner Tagebücher ins ferne Deutschland angeboten.
Ich mache eine ärgerliche Entdeckung: meine Kamera ist gestohlen worden! Das entbindet mich zwar bis auf weiteres von der mitunter lästigen Pflicht des Fotografierens, denn mein zweites Gehäuse hatte ich defekt mit Mexl & Wexl, zwei urigen bayerischen Fahrradfreaks, von Istanbul auf die Heimreise geschickt, doch bin ich traurig über den verlorenen Film, auf dem ich, wie ich meine, die schönsten Bilder der bisherigen Reise festhielt. Die Einkreisung des möglichen Täters fällt schwer, habe ich doch seit dem Tag der Lastwagenfahrt kein Bild mehr geschossen. Mein Verdacht fällt auf den Fahrer, der meinen körperlichen Zustand genutzt haben könnte, unbemerkt... das ist das Furchtbare: man verdächtigt zwangsläufig eine Menge Leute und lediglich einer ist's gewesen. Außerdem: wenn es jemandem möglich war, den Photo unbemerkt zu entwenden, habe ich einfach nicht scharf genug aufgepaßt!
Zum Seitenbeginn
Zum PapyrusArchiv
![]()
![]()
Folge 3 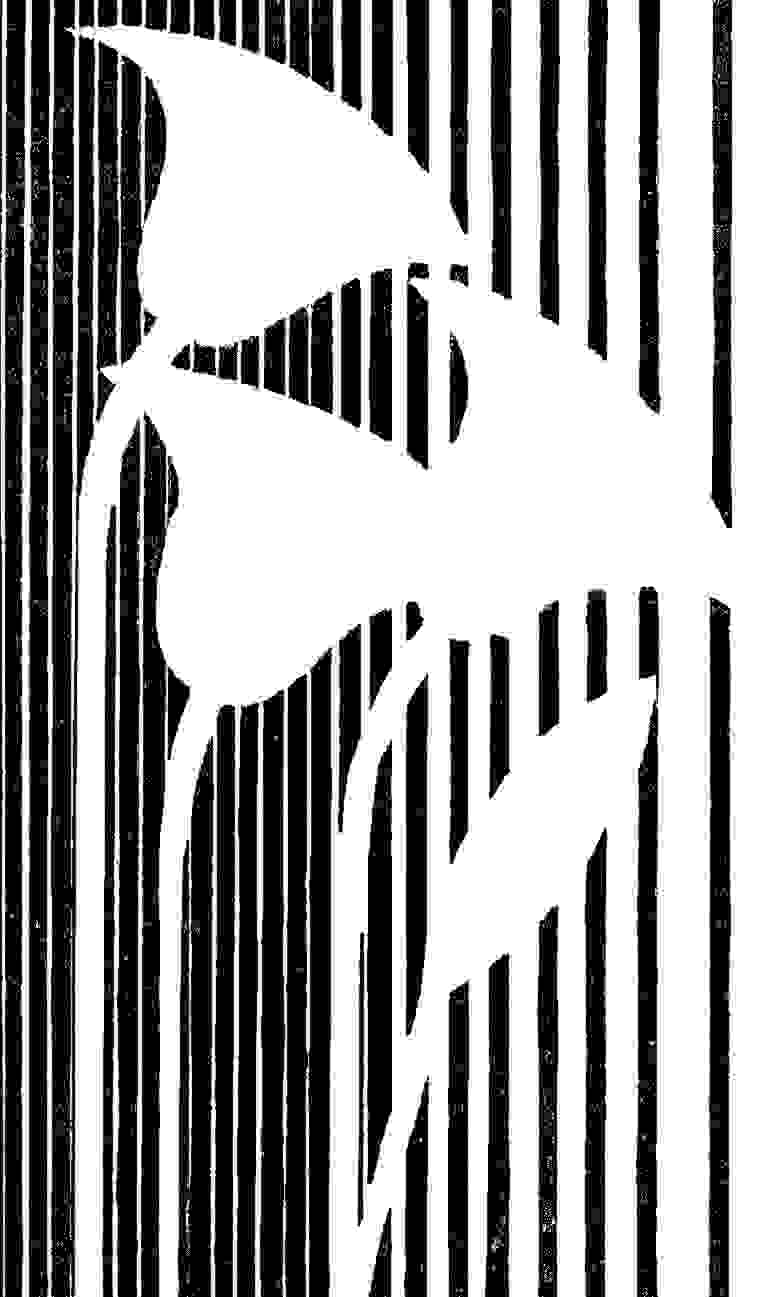 Nr. 5—6/90, pp. 94—96
Nr. 5—6/90, pp. 94—96
Mein zweiter Startversuch nach dieser Woche der Rekonvaleszenz verläuft hoffnungsvoller, in Aleppo hole ich noch mal meine "Rotel-Rotte" ein und komme – unter Schmerzen allerdings – bis nach Damaskus.
Die Altstadt überwältigt mich, völlig unvorbereitet wie ich bin, zieht sie mich für vier Tage in ihren Bann. Immer wieder streife ich ungläubig forschend durch das scheinbar unüberschaubare Gewirr der Gassen und Gäßchen, Torbögen und Plätze, das sich aus der harmonischen Masse der weißen Lehmmauern in meinen Augen langsam zu individuellen, charakteristischen, wenngleich namenlosen, Orten formt. So dicht sind die Häuserzeilen aneinander gebaut, daß die Gitter der gegenüberliegenden Gebäude einander zu stützen scheinen und den Himmel über den staubigen Gassen zu einem handbreiten blauen Streifen zusammenpressen.
Nahe der Omayaden-Moschee gestattet die ehrwürdige Stadt einen flüchtigen, erhaschten Blick nur in ihre vieltausendjährige Geschichte, wo schlanke Säulen mit reich verzierten Kapitellen gleich zarten Pflanzen aus den Fugen des steinernen Häusermeeres sprießen.
Im jordanischen Petra, dem antiken Zentrum des versunkenen Nabatäerreiches, geht die Pracht der Natur mit den Zeugnissen menschlicher Zivilisation eine sinneberauschende Synthese ein, die einen in ihrer Erhabenheit der Farben, Formen und Elemente ganz still werden läßt. Noch heute erscheint es rätselhaft, wie dieses Volk in so lebensfeindlicher Umgebung zu dieser kulturellen Blüte gelangte. Die Nabatäer muß ausgezeichnet haben, was unserer Zivilisation abgeht, woran sie krankt und was sie zu zerstören droht: in einzigartiger Weise verstanden sie es, die spärlichen Ressourcen der Natur, im besonderen das wenige Trinkwasser, in sparsamer und schonender Weise zu nutzen. Angesichts der kristallklaren, türkisblauen Fluten des Roten Meeres bei Aqaba erscheinen die erregten Farbspiele des Sandsteins von Petra nunmehr wie die bunten Blüten eines surrealistischen Traumes, verzaubert und entrückt.
Nuweiba! Hier betrete ich seit rund sechs Jahren das erste Mal wieder ägyptischen Boden – ein Heimkommen in das Land meiner schönsten Kindheitserinnerungen...
Doch gegenüber damals sind die – meist negativen – Veränderungen auf dem einstmals paradiesischen Sinai offensichtlich, und ich bin unsäglich traurig: geht hier ein weiteres Stück einmaliger Naturschönheit durch Menschenhand unwiederbringlich verloren?
Die filigranen Steinkorallen zertrampelt von achtlosen Touristenhorden, abgebrochen von rücksichtslosen Souvenirsammlern, bedroht von der zunehmenden Wasserverschmutzung durch Abwässer und Rückstände aus der Erdölprospektion; der Fischreichtum kurzsichtig dezimiert durch unfaire Harpunenjagd; die einsamen Strände verbaut durch Feriendörfer und Hotelkomplexe und begraben unter den Massen des Plastikmülls; die schweigende Erhabenheit der Bergwüste entweiht durch lärmende Touristengruppen und ihre Abfälle; das ehemals stolze Beduinenvolk erniedrigt zu Dienstboten der finanzkräftigen Urlauber? All diese Symptome treten im Sinai bereits auf. Noch überwiegen die einsamen Strände und Riffe, kann man sich als Fisch unter Fischen durch die zauberhaften Korallengärten bewegen, staunend und bestaunt. Doch die Entwicklung der letzten Jahre scheint den Weg für die Zukunft vorzuzeichnen...
Ich möchte allein sein! Im weichen Licht des Nachmittags beginne ich mit dem Aufstieg, und gute drei Stunden später stehe ich auf dem Katharinenberg, dem Dach des Sinai – und der Welt, so will es mir scheinen. Die unter mir ausgebreitete Gebirgslandschaft des Sinai schwelgt im wollüstigen Chaos. Angesichts dieser Orgie von Farben, Formen und Strukturen, dem Kampf des erregenden Rots des erleuchteten Bergrückens gegen die aufsteigende Kühle des süßlichen Gifts der Dunkelheit, die im Schatten der Täler kauert und sich mit dem Glühen der Sonne als bläulicher Dunst auszubreiten beginnt, die Reflektion des Lichts unter sich erstickend, empfinde ich stärker als je zuvor die Helligkeit der Wüste. Unter mir verschwimmt die Welt im dunklen Nebel der Vergessenheit, lediglich die Spitze des Mosesberges mit seiner Kapelle ragt aus diesem Meer der Trauer und Sünde, von einem einzelnen göttlichen Strahl der untergehenden Sonne in die Ewigkeit des Lichts entrückt – dann zerbricht auch diese Illusion, ich bin allein – allein mit Gott. Als am nächsten Morgen drei deutsche Touristen den Gipfel stürmen, ist für mich die Zeit gekommen, ich flüchte in die stillen Wadis unterhalb des Gipfels.
"Henry Moore was here!" vermeine ich den wunderschönen, rundgeschliffenen Formen des Rosengranits in einem dieser Täler entnehmen zu können, eine ganze Landschaft, welch würdiges Gegenstück zu dem Lebenswerk des englischen Künstlers.
|
Es ist soweit: der stärker werdende Wunsch, endlich Kairo zu erreichen, läßt sich nicht mehr verdrängen! So hole ich mein Rad von Basata wieder auf die Straße, danke Sherif für seine großzügige Gastfreundschaft und gehe die letzten 400 km nach Kairo, dem ersten großen Zwischenspiel meiner Reise an.
Im Sektor C überholt mich ein begeistert johlender Truppentransporter der MFO, der mir, gemeinsam mit der Besatzung des folgenden Checkpoints dort einen triumphierenden Empfang bereitet. Geduldig wie ein Kamel lasse ich mich mit jedem der Jungs aus Kolumbien samt Fahrrad ablichten, aufgeregt wie die 7. Klasse einer Mädchenschule stellen sie mir ihre interessierten Fragen zu der Tour alle gleichzeitig – ehrfürchtiges Raunen und anerkennendes Schulterklopfen der harten Männer sind die rührende Reaktion auf meine Antworten. Unsere Unterhaltung gipfelt schließlich in der Fachsimpelei über die erstklassigen kolumbianischen Radprofis. Dann werden für mich ungeheure Träume wahr: die Speisekammern des Postens werden für mich umgeschichtet und ein beträchtlicher Teil ihrer selbst wandert in meine Taschen. Ich schwelge in Apfelsinen, Bananen, Pflaumen, Trauben, Joghurt und: schließlich werden mir noch ein halbes Kilo echten kolumbianischen Kaffees sowie köstliche Kaffeebonbons zugesteckt. Derart reich beehrt und beschenkt gehe ich mit meiner Kraft die noch beträchtliche Distanz vor mir an.
Vom Fluch des Pharaos und von Mandelentzündung heimgesucht wird die geplante Reise in die Nostalgie zur Qual, doch als ich schließlich durch die Kairoer Innenstadt fahre, ist all dies vergessen: Sie steht noch, die "Siegreiche" – ich bin wieder daheim!
Zum Seitenbeginn
Zum PapyrusArchiv
![]()
![]()
Folge 4 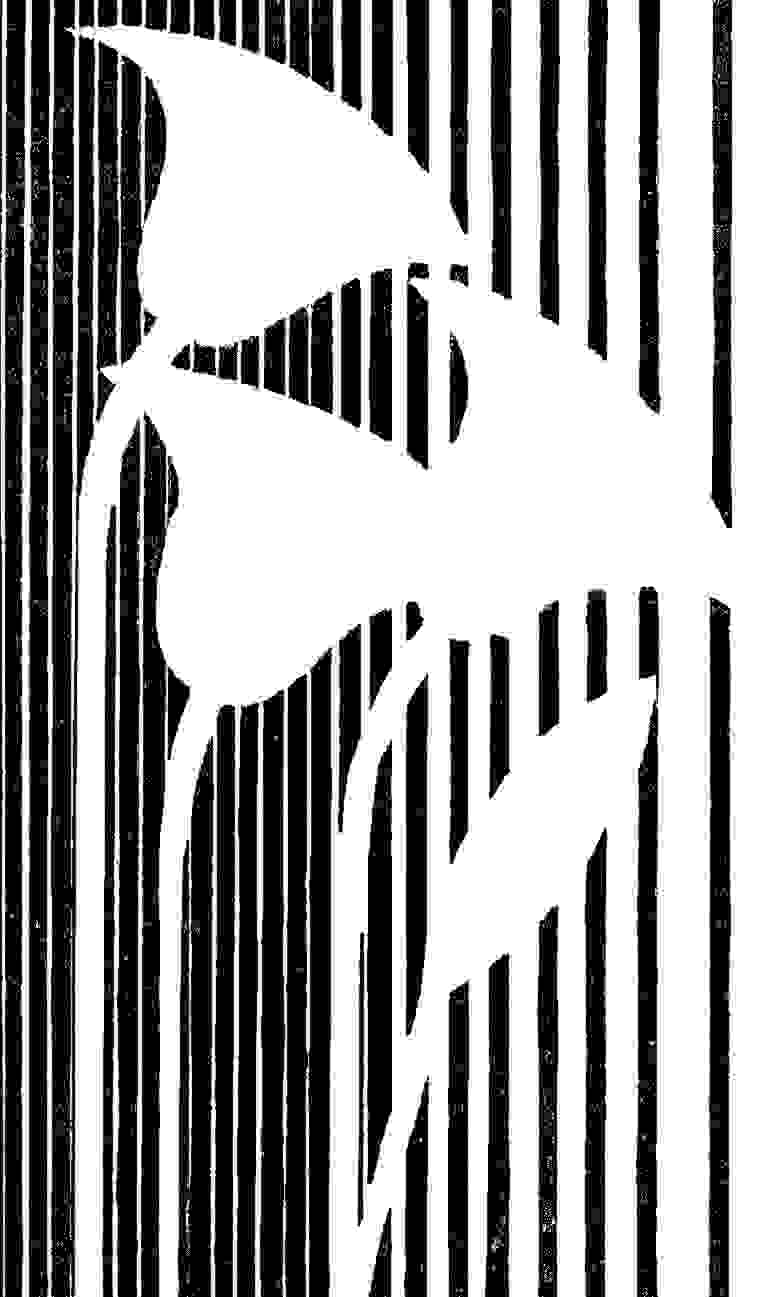 Nr. 11—12/90, pp. 89—94
Nr. 11—12/90, pp. 89—94
Einen Moment zögere ich, dann fällt der Schlüssel klirrend durch den Briefschlitz – nach über einem Monat Pause in Kairo bin ich wieder unterwegs! Die Wochen hier waren angefüllt mit dem Wiedersehen alter Freunde und Bekannter, natürlich besuchte ich neben all den anderen Sehenswürdigkeiten den Sphinx und die Pyramiden von Gizeh, ich unternahm ausführliche Streifzüge in den Altstadtvierteln und Bazargassen der 15 Millionen-Einwohner-Stadt, die trotz des Verkehrs, des Lärms, des Schmutzes und der Armut ihren unwiderstehlichen Reiz mir gegenüber schamlos ausgespielt hat, denn später als ursprünglich geplant lasse ich die Metropole Ägyptens in meinem Rücken, dem Lauf des Nils Richtung Süden, ins Innere Afrikas, zu folgen.
Nach den Wochen des Vagabundenlebens auf den Straßen Südeuropas und des Nahen Ostens war es eine Wonne, die rührende Fürsorge Wilma Dambecks zu spüren, einer guten Freundin meiner Eltern aus vergangenen Tagen, die mich wie ihren eigenen Sohn bei sich aufnahm! Welch ein heimeliges Gefühl, für Tage, ja Wochen, im selben Bett zu schlafen!
Doch obgleich ich die kulturellen wie kulinarischen Angebote der Weltstadt genießerisch auskostete, mich gleichsam die Fesseln des Komforts eines seßhaften Lebens zu umgarnen begannen – meine Reiselust ist ungebrochen!
Am westlichen Ufer sehe ich die Silhouette der Pyramiden von Gizeh langsam vorüberziehen, die sich – so will es mir scheinen – beschämt ihrer Entwürdigung, in den Schatten neuer Wolkenkratzer kauern, welche ihr jahrtausendealtes Recht, den Lauf des Nils, sein Steigen und Fallen – gleichbedeutend mit Leben und Sterben in Ägypten – als stumme Zeugen der Zeit zu betrachten, durch ihre aufragende Größe lästerlich herausfordern.
Mit dem Verlassen der staubigen Smog-Glocke des Großraumes Kairo atme ich befreit auf! Schöner kann Radfahren kaum sein, treibt mich doch ein stetiger Nordwind über die hügellose, schnurgerade Teerstraße, daß die ländliche Szenerie der Lehmdörfer, der Palmenhaine, Wasserbüffel und Esel förmlich an mir vorüberfliegt.
Mein Rad ist hochbepackt, denn entgegen aller guten Vorsätze lassen wir die Fleischtöpfe Kairos mit erhöhtem Ballast hinter uns. Jenen weiter zu verringern hätte bedeutet, Gitarre und Zelt zurückzulassen, ein Schritt, zu dem ich mich schließlich doch nicht durchringen mochte, wäre doch die fehlende Klampfe bei den musikvernarrten Arabern und Afrikanern für mich ohne Zweifel gleichbedeutend mit einem merklichen Profilverlust, das fehlende Zelt eine massive Einschränkung meiner Freiheit und des Komforts (paradoxerweise muß letzteres ersteres nicht ausschließen!). Ansonsten hab ich inzwischen gelernt, Verluste von Teilen meiner Ausrüstung durch Diebstahl, Verlieren oder Defekt als einen Vorgang der natürlichen Selektion zu betrachten, durch den die gesamtökologische Beziehung zu meiner Umwelt eine überaus erfrischende Dynamik erfährt, ein Vorgang, der meine Improvisier- und Anpassungsfähigkeit in unvorhergesehenen Situationen auf das Wertvollste fördert und der letztendlich den eindeutigen Nachweis führt, wie viele, im Grunde doch völlig überflüssige Dinge man selbst noch auf dem Fahrrad mitzuschleppen imstande ist ...
|
Von zwei radfahrenden Fellachenjungen, Abdallah (dt. Diener Gottes) und Ahmed, hinter dem Ort es-Saff in bewegender Weise von der Straße weg zur Übernachtung ins Haus ihrer Familie eingeladen, ziehe ich in einer buntgemischten Karawane der von den Feldern heimkehrenden Bauern mit Kamelen, Ziegen, Eseln und Wasserbüffeln in das Lehmhüttendorf ein.
Argwöhnisch wird darauf geachtet, daß jede der beiden Gastgeberparteien ihren Teil vom Gast und damit von seinem Ansehen erhält. Die Kunde meiner Anwesenheit im Dorf verbreitet sich schnell und bis 1 Uhr 15 morgens defiliert die Männerwelt des Dorfes durch das Wohn- und Schlafzimmer der Familie Abu Risq, den radfahrenden Chawaga (dt. Fremder) zu begucken.
Es ist kalt am darauffolgenden Morgen, der Atem wird zu blassem Rauch, als wir im sauberen Innenhof des Lehmhauses ums Feuer sitzen, über dem Abd-al-Mohsen, gemäß seinem Ansehen und Stand mit Gewissenhaftigkeit und fast feierlichen Gesten die Durra (dt. Mais) röstet. Das eigentliche Frühstück schließt sich mit heißer, gezuckerter Büffelmilch, Ful (Bohnen), Ta'ameya (in Fett gebackenem Bohnen-Tofu), Eiern und Brot unmittelbar daran an und findet mit dem allgegenwärtigen Shai, dem äußerst starken und reichlich gezuckerten arabischen Tee) ein würdiges Ende. Mit solch gesunder Basis radle ich zuversichtlich auf der neuen Teerstraße in die Wüste hinaus. Der Übergang vom Fruchtland zur Ödnis ist wie mit dem Messer gezogen, und dieser abrupte Wechsel folgt jener Linie, bis zu welcher der Nil seit Ewigkeiten Jahr für Jahr während der Überflutung den fruchtbaren Nilschlamm absetzte, bis die Errichtung des Hochdamms von Assuan diesen natürlichen Rhythmus zerstörte.
So schmal wird der grüne Streifen zwischen Fluß und Wüste hier am östlichen Ufer, daß selbst die braunen Würfel der kleinen Bauernhäuser am Rande der Wüste stehen, um nicht einen Quadratmeter des wertvollen Kulturlandes zu vergeuden.
Aus dem Dunst des Flußtales grüßen mich die alles überragenden Masten und die weißen Segel der Felukken, jener riesigen Transportkähne, die auch heute noch einen mächtigen Teil des Flußhandels zwischen Ober- und Unterägypten abwickeln, und versichern mich der beständigen Begleitung des Stromes jenseits der sandigen Hügel zu meiner Rechten. Die Nacht verbringe ich in einem kleinen, einsamen Gasthaus am Rande der Wüstenstraße, mit dessen Besitzer Shehata, einem konservativen, einfachen Mann aus einem kleinen Dorf, keine 5 km von hier, ich eine tiefgreifende Diskussion über Sünde, Sex und Blutrache führe. Auf meine Frage, ob Blutrache denn überhaupt noch existiere, erzählt er mir, erst vor einem halben Jahr seien ihr in seinem Dorf vier Männer zum Opfer gefallen, nachdem ein Bauer im Streit um Grund und Boden erschlagen worden war. Mein Schlaf später wird immer wieder durch Shehates infernalisches Schnarchen und seine periodischen Raucherhustenanfälle gestört, deren hörbar erkleckliche Prospektion er ungeniert auf dem Boden plaziert. Außerdem trage ich Quälgeister mit mir herum, die nachts munter werden und mich durch das Jucken ihrer Bisse schier zum Wahnsinn treiben. Flöhe, soviel weiß ich bereits sicher aus meinen einschlägigen Reiseerfahrungen, sind es jedenfalls nicht!
Shehata verzehrt zum Frühstück zwei Biskuits, setzt sich dann vor's Haus in die wärmende Sonne, stopft sich eine Wasserpfeife und zieht eine ominöse Streichholzschachtel aus der Tasche. Dies, so bedeutet er mir ernst, auf unser gestriges Gespräch bezugnehmend, sei auch "haram", also Sünde im Sinne des Koran, um dann mit Seelenruhe das Haschisch unter den Tabak zu mischen und sich das erste Pfeifchen an diesem noch jungen Morgen zu genehmigen.
In Minia wechsle ich auf die westliche Nilseite über, vertiefe in einer ausschweifenden Exkursion meine Kenntnisse über die exzellente und preiswerte ägyptische Küche (Kosheri, Linsen, Reis und Nudeln mit gerösteten Zwiebeln sowie Ros bi laban, eine Art Milchreis), um mich solcherart am Leib gestärkt, nach Beni Hassan aufzumachen, den Geist an den rund 4.000 Jahre alten Malereien der dortigen pharaonischen Nekropole zu erfreuen. Die Frische der Farben, die Lebendigkeit der Darstellungen sowie die Detailtreue der Künstler freilich lassen einen das Entstehungsdatum vor einigen Dekaden denn vor 40 Jahrhunderten vermuten. Es ist regelrecht spannend, an den überdimensionalen Comic-Seiten dieser Altägyptensaga entlangzugehen, und auch wenn man den hieroglyphischen Begleittext nicht zu entziffern vermag, erzählen einem die Bildergeschichten vieles über die Landwirtschaft, das hochentwickelte Handwerk, die vielfältigen Jagdtechniken, den hehren Kampfsport und die pompösen Zeremonien um den Gottkönig/Pharao im alten Ägypten.
Nach dem Besuch des Gräberfeldes bleibe ich schwatzend in dem urigen Laden des Elektrikers Abdallah hängen. Shai trinkend, Libb (Kürbiskerne) und Fulsudani (Erdnüsse) knabbernd, konferieren wir mit den Oberhäuptern zweier umliegender Dörfer und darüber hinaus mit recht wechselhaftem Publikum über gewichtige Dinge, denn als ich unvorsichtig äußere, Bruder zweier noch unverheirateter, blonder Schwestern zu sein, versucht man eifrig, mich in einen Brauthandel zu ziehen. Es wird laut und lustig, ich selbst freue mich, langsam den Sprachwitz des Arabischen zu erfassen.
Der Schlafsack ist feucht und schwer vom Tau der Kanäle und des nahen Stromes. Fröstelnd stemme ich mich bei Sonnenaufgang in die Pedale. Nach heftigem Preisgerangel werde ich schließlich doch samt Fahrrad für den Einheimischentarif auf das östliche Ufer nach Tell-el-Amarna übergesetzt.
Tell-el-Amarna, so heißt die in Trümmern liegende Hauptstadt des Ketzerkönigs Echnaton und der drei nachfolgenden Herrscher (unter ihnen der jugendlich verstorbene Tut-anch-Amun, der viele tausend Jahre später ein unglaubliches Comeback feiern sollte), welcher radikal mit dem Vielgötterkult des Alten Ägyptens brach und Amun-Ra, den Sonnengott, zur alleinigen Gottheit erhob. Der geballte Zorn der reaktionären Priesterkaste fegte die frevlerischen Kultrevoluzzer vom Thron der Macht, die es gewagt hatten, die heiligen Stätten im ganzen Land auf das Unglaublichste zu schänden.
Amarna ist mit seinen kümmerlichen Lehmmauerresten für den von kolossalen Granitbauten verdorbenen Ägyptentouristen wenig aufschlußreich. Allein, bei meinem Gang über das Schuttfeld werde ich in anderer Sache fündig: Als ich Hatem und Ahmed, die beiden hatten sich im Dorf dienstfertig meiner Suche nach den Altertümern angeschlossen und waren seitdem nicht von meiner Seite gewichen, von den Plagegeistern berichtete, die mir seit einigen Tagen den wohlverdienten Schlaf streitig machten, meinen sie übereinstimmend, meiner Beschreibung nach könne es sich lediglich um Al Baqq – die Wanze handeln. Als ich jedoch in der folgenden Nacht erneut einen Fang tätige und diesen aufmerksam mit einer Abbildung in der Gesundheitsfibel vergleiche, bevor ich ihn voll Genugtuung mit einem Knacken zwischen den Fingernägeln zerquetsche, tippe ich eher auf Kleiderläuse.
Bei meiner Rückkehr zur Baladi-Fähre (Baladi: dt. Volks-, Einheimischen-) findet der Preiskampf in einer zweiten Runde vor dem Publikum von 150 Schulkindern, die lärmend mit uns die 12 m lange Schaluppe bevölkern, eine würdige Fortsetzung, denn der Kapitän ist offensichtlich nicht gewillt, die vorhergegangene Schlappe ohne Revanche einzustecken. Der Geräuschpegel der Auseinandersetzung steigt merklich an, und um beiden Parteien ein Verlassen der Arena ohne Gesichtsverlust zu ermöglichen, bestehe ich zwar auf dem Bezahlen des normalen Preises, unterstreiche aber meine Hochachtung vor der verantwortungsvollen Tätigkeit des Kapitäns, das alte, tuckernde Bötchen unter dieser extremen Beladung sicher über den Nil zu steuern, mit einem würdigen Bakschisch. Als wir schließlich doch noch in die Nähe des gegenüberliegenden Ufers kommen, drängt sich alles an die Reeling, so daß die Nußschale bedenkliche Schlagseite bekommt und das Wasser hereinschlägt.
Die Sonne rutscht bereits als roter Ball hinter den Zaun der schwarzen Palmenreihen, da schließt kurz vor Manfalut ein Radrennfahrer in zünftiger Radlerkluft und italienischem Markenrad zu mir auf. Ich bin – bildlich gesprochen – ziemlich überfahren und noch bevor ich mich von der Überraschung erholt habe, bringt mich Nassei, Steward bei Egypt Air und Nummer drei des ägyptischen Radsports, im Jugendzentrum der Stadt unter. Ich bin ehrlich begeistert angesichts der Tatsache, mich in sieben leeren Doppelbetten ausbreiten zu können!
Wie Lauffeuer eilen mir die aufgeregten Agnabi- und Chawaga-Rufe der Kinder entlang der Kanalufer voraus, und neugierig wenden sich die Wäsche und Geschirr waschenden Mädchen an den Wasserstellen nach mir um; Frauen, die in aufgehängten Ledersäcken die Wasserbüffelmilch zu Butter schütteln, halten staunend mit der Arbeit inne. Aufmunternde und witzig-freche Bemerkungen werfen mir die Männer zu, die in den Kaffeehäusern Tee trinkend, spielend und Wasserpfeife rauchend den Nachmittag verbringen.
|
Als ein seit 4.000 Jahren unverändertes Bild ziehen Bauern mit dem Ochsenpflug über die Felder und kleine Mädchen mit lustig abstehenden Zöpfen und bunten Kleidern stehen als hundertfaches Abziehbild der kleinen Hexe am Straßenrand. Sie winken mir begeistert zu, als wäre ich der Kaiser von China.
Rinder, die Augen verbunden, trotten, mächtige Wasserräder antreibend geduldig im staubigen, endlosen Rund. Ein Bauer sitzt, als Schattenriß seiner selbst, arbeitend vor dem leuchtend grünen Schrein des von der Nachmittagssonne durchschienenen Kleefeldes. Vorbei an den mächtigen Blechen mit in der Sonne gehenden Aisch-Schams (Sonnenbrot) geht meine Fahrt durch die endlose Kette der Dörfer unaufhaltsam nach Süden. Rot-schwarzweiß explodieren die Federballen der Wiedehopfe, wenn sie bei meinem lautlosen Herannahen erschrocken vom staubigen Straßenrand in die gleißende Sonne auffliegen. Die weißen Flocken der Kuhreiher durchsetzen das satte Grün der üppigen Felder, über denen ein makelloser Nachmittagshimmel sein blaues Tuch spannt. All diese Eindrücke und Bilder wachsen zu einem komplexen Gemälde vom üppig schwelgenden Fest der Farben Ägyptens zusammen, eine Orgie, die berauscht, fasziniert, fesselt.
Nach der Mammutetappe von 185 km erreiche ich am fortgeschrittenen Abend Abydos, von einer Menge johlender und bakschischfordernder Kinder umringt, die mich schließlich zu Hamadi eskortiert, dem liebenswerten Sohn des Bürgermeisters. Auf sein bereitwilliges Angebot hin werde ich die kommende Nacht das erste Mal im Vorgarten einer bürgermeisterlichen Residenz mein Haupt betten.
Zuvor jedoch, um meine Pflichten als guter Gast inzwischen wohl wissend, ergreife ich widerspruchslos meine Klampfe. Ich bin nach dem langen Tag so hundemüde, daß ich über dem Gitarrenspiel fast einschlafe. Dennoch ist Mohamed, Englischlehrer der örtlichen Mittelstufenschule so beeindruckt, daß er mich bittet, zusammen mit Hamadi seinen morgigen Unterricht zu besuchen.
30 dunkle Augenpaare fühle ich aufmerksam auf mich geheftet, mucksmäuschenstill ist es, als ich den Jugendlichen in Arabisch von meiner Reise erzähle. Doch als ich zum Abschluß noch einige Lieder zum Besten gebe, schwillt der Geräuschpegel begeistert an.
Hamadi zeigt mir das andere Abydos, das dem Normaltouristen ansonsten verschlossen bleibt, denn es ist ausgesprochen unerwünscht, daß sich die zahlreich einfindenden Touristenscharen außerhalb des prächtigen Tempels im Dorf umtun. Begeistert bin ich von dem bunten, quirligen Wochenmarkt, auf dem die Bauern der umliegenden Dörfer die reichen Früchte ihrer Feldarbeit darbieten.
Zum Seitenbeginn
Zum PapyrusArchiv
![]()
![]()
Folge 5 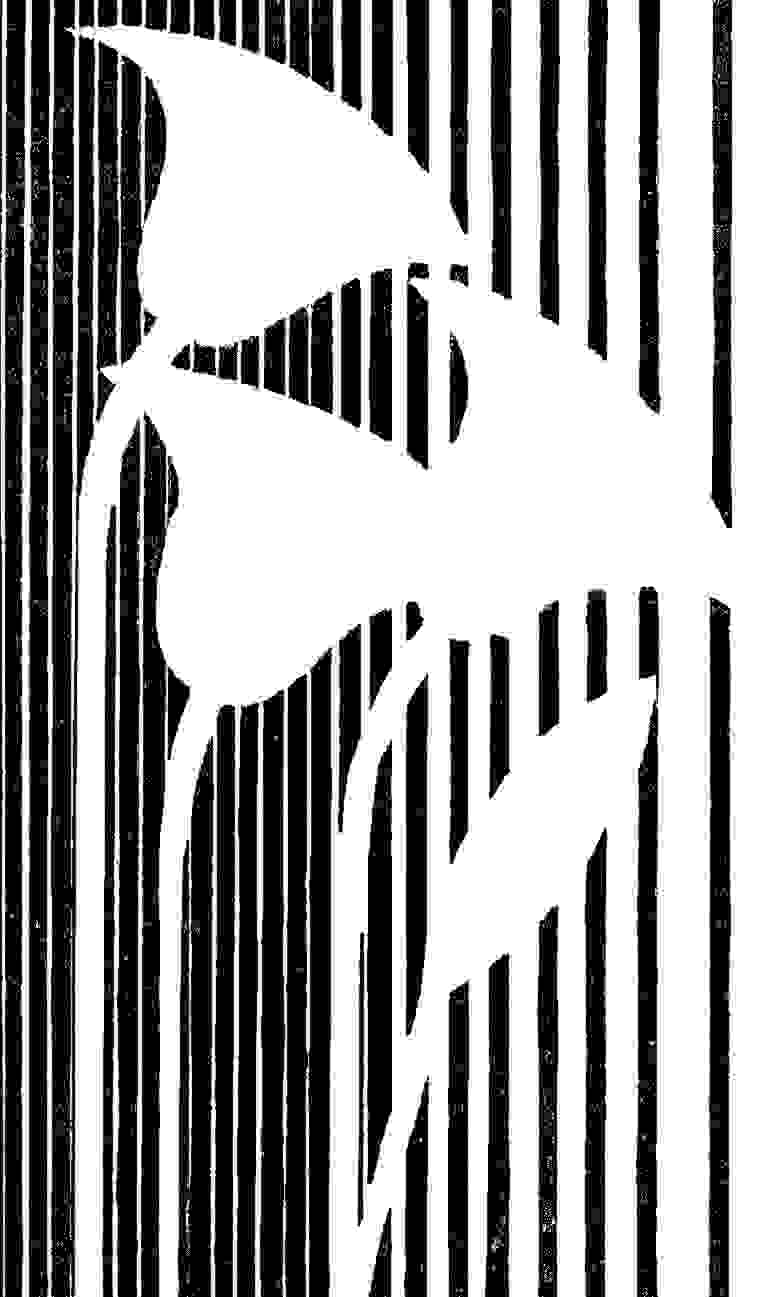 Nr. 1—2/91, pp. 105—109
Nr. 1—2/91, pp. 105—109
Immer öfter steht die Landschaft bis zum Hals im grünen Meer des 4—5 Meter hochaufragenden Zuckerrohrs und vielerorten ist die Erntearbeit in vollem Gange, werden die Waggons der Schmalspurbahn kunstvoll mit den grünen Stangen beladen. Süßlicher Kamelduft schwängert die Luft um die Zuckerfabrik Nag-Hamadi, der dem Gestank der Autoabgase entschieden vorzuziehen ist...
Auch Kamele transportieren das Zuckerrohr. Die Tiere sind so hoch bepackt, daß lediglich Hals, Kopf und Beine unter der grünen Last hervorlugen, welche wegen des merkwürdigen Ganges der Dromedare hin und her wippt, und es sieht so aus, als tanzten sie nach einem lustigen Rhythmus mit grünen Baströcken Hula-Hupp.
Die kommende Nacht verbringe ich in dem neuentstehenden Familiensitz einer oberägyptischen Großgrundbesitzerfamilie, die mich in einem Akt der Barmherzigkeit bei Einbruch der Dunkelheit ohne große Umstände von der Straße weg in ihr Reich entführte, das in seiner Gesamtheit mehr als 50 Häuser der umliegenden Dörfer, ausgedehnte Zuckerrohrpflanzungen, Obstgärten und weitere Anbauflächen umfaßt. Offensichtliches Zeichen dieses Wohlstandes sind die Motorräder der jüngeren unter den anwesenden Männern.
Die Bodenkachelung der feudalen Residenz (drei ausladende Geschosse und heiße Dusche (!)) ist noch nicht fertiggestellt, und so sitzen wir im Empfangszimmer, um einen raumgestalterisch interessanten Sandhaufen. Ich soll mich wie zuhause fühlen, ermuntert mich Rashad, die untere Etage sei ja nur für Gäste gedacht und fügt dann entschuldigend "nur eine Kleinigkeit" hinzu, als mir ein dampfender Teller mit köstlichem Entenfleisch und frischen Kartoffeln vorgesetzt wird, den ich unter den wohlwollenden Blicken meiner großzügigen Gastgeber mit sichtlichem und hörbarem Genuß leere.
Ich merke der männlichen Familiendelegation – vom 20-jährigen Jüngling bis zum würdig ergrauten Greis – eine unerklärliche Spannung an: Natürlich! Wieder einmal meine Gitarre! Die Höflichkeit untersagte es, mich vor der Stärkung um die musikalische Unterhaltung zu bitten, und so saßen sie da, einer neben dem anderen, wie Kinder vor der Weihnachtsbescherung, Neugier und Vorfreude nur schlecht verbergend.
Im Verlauf des fortschreitenden Abends erhalte ich von 12-jährigen Lehrern eine Nachhilfestunde im Zuckerrohressen, während derer ich etwas um das Geheimnis der Geschicklichkeit und atemberaubenden Geschwindigkeit zu ahnen beginne, mit der schon die kleinsten Kinder mittels der Zähne das Rohr von der harten, grünen Schale befreien, um an den weißen, faserigen Kern zu gelangen, dem man dann durch Auskauen den zuckrigen Saft entzieht. Meine bisherigen Versuche endeten meist frühzeitig mit schmerzenden Kiefern und klebrig verschmiertem Gesicht und Händen in hohem Maße unbefriedigend.
Nach einem üppigen ägyptischen Bauernfrühstück in der ruhigen Gesellschaft Rashads ziehe ich mit den Jüngeren in einen der herrlichen Obstgärten, und so breche ich erst gegen Mittag auf, mit dem gut gemeinten Geschenk von 10 kg Yussuf Efendi (Mandarinen) hoffnungslos überladen. Das Argument, das Obst sei auf meinem vollbepackten Rad nicht mehr unterzubringen, wird mit einer Schnur und ägyptischer Phantasie und Geschicklichkeit flugs entkräftet, die Last in bewegender (im wahrsten Sinne des Wortes!) Form außenbords vertäut.
Die Veränderungen der Architektur zwischen Dendera und Luxor sind offensichtlich: Zunehmend mehrstöckig werden in die Mauern der Häuser Fuchar, mächtige Tonkrüge, eingearbeitet, wohl zu Isolationszwecken, so meine Vermutung. Öfter als bisher schmücken die bunt-illustrierten, naiven Darstellungen von Pilgerreise und Kaaba, dem würfelförmigen Heiligtum von Mekka, die Häuserfronten der Hajjis. Auch die Grabmäler der Sheikhs werden hier – mit zahlreichen bunten Fähnchen – auffälliger geschmückt und genießen größere religiöse Verehrung als ich dies weiter nördlich beobachten konnte. Zweimal sehe ich Exemplare der mächtigen Nilwarane über der Türschwelle zu Wohnhäusern befestigt, und die Kinder bestätigen mir auf meine Frage die Vermutung, daß sie, ähnlich der stilisierten Hand der Fatima (Tochter des Propheten Mohamed) als Amulett Glück verheißen und den "Bösen Blick" abwenden sollen. Die Ausmaße des Touristenrummels in Luxor sind bereits abschreckend, und verzweifelt flüchte ich in die ruhige Atmosphäre des wunderschönen Museums der Stadt. Die begrenzte Anzahl der Exponate wandelt sich durch ihre sorgfältige Auswahl und eine gute Beleuchtung in einen Vorteil, dem man Muße verdankt, jedem der Stücke einen angemessenen Teil seiner Aufmerksamkeit zu schenken. Meine heimlichen Favoriten sind die zwei identischen, übermächtigen Echnaton-Köpfe, die, aus warmem Sandstein gearbeitet, mit der Überzeichnung der Charakteristika des Ketzerkönigs bereits karikaturhafte Züge tragen. "Das ist doch Mick Jagger", ruft ein aufgeregter Brite neben mir aus, und in der Tat, eine gewisse Ähnlichkeit der ausgeprägten Kinnpartie und vor allem des riesigen Mundes sind nicht zu bestreiten.
Zehn Tage und 1.000 km Niltal liegen hinter mir, als ich im schönsten Licht den ersten Nilkatarakt erreiche. Wenn die sinkende Sonne über die dunklen Dünen des westlichen Ufers streicht und das rote Schimmern des Sandes mit dem tiefdunklen, beinahe schwarzen Blau des Nils und dem frischen Grün des zum Ufersaum geschrumpften Pflanzengürtels zur absoluten Maxime der Farbgebung wird, durchzogen von den weißen Segeln der Felukken, wie von meditativen Gedanken, still und groß, dann, und nur dann, wird das Geheimnis des Zaubers ersichtlich, der diese Stadt für mich zu einem der schönsten Flecken auf dieser Erde erhebt!
Meine Odyssee auf der Suche nach einer preiswerten Unterkunft führt mich schließlich ins Mullah-Hotel, das inklusive Frühstück 4,10 ägyptische Pfund kosten soll. Die Qualität seiner pauschalen Mahlzeiten habe ich bereits bei meinem Aufenthalt in Luxor mit knurrendem Magen registriert, und so feilsche ich mit Anwar, dem manager-on duty, um die Entlassung aus der allgemeinen Frühstückspflicht, verbunden mit einer Tarifreduzierung auf 3 Pfund – wir sind schließlich im Orient, wo um alles und jedes gefeilscht wird; und: Wo bleibt ansonsten das Vergnügen bei einer solchen Reise? Die Auseinandersetzung hält, was sie verspricht, in Anwar habe ich einen geschickt lavierenden, ebenbürtigen Counterpart gefunden, und so kostet es mich eine halbe Stunde schweißtreibender Schwatzerei, Schmeichelns, Drohens und Witzereißens, kurz, die Aufbietung meiner gesamten Arabischkenntnisse vor der Kulisse des halben Hotelpersonals, das den Unterhaltungswert der Vorstellung offensichtlich zu schätzen weiß, bis ich Anwar, das nubische Schlitzohr, endlich weichgeklopft habe...
Aus dem gegenseitigem Respekt entwickelt sich eine echte Zuneigung, und als Ausdruck seiner ehrlichen Anerkennung verspricht er mir mit einem vieldeutigen Augenzwinkern, mich zu einer neuseeländischen Touristin ins Zimmer zu stecken. Diese, von meinem Einzug rüde aus dem Schlaf gerissen, äußert arglos ihre Verwirrung darüber, daß im moslemischen Ägypten ein fremder Mann bei einer Frau einquartiert wird ... oh, unschuldiges Gemüt. Ich erwidere harmlos die vorsichtige Vermutung, dies ließe sich eigentlich nur mit der Überbelegung des Hotels erklären ... eigentlich ... um mich dann hastig, weiteren Fragen ausweichend, unter die Dusche zu flüchten.
Mit vollbepacktem Rad tingele ich in der arabischen Rush-hour durch die überfüllten Gassen des Souks, die letzten Lebensmittelbunkerungen für die morgige Schiffsreise über den Assuanstausee in den Sudan vorzunehmen. Im dichtesten Gewimmel werde ich von Swen, einem holländischen Islamwissenschaftsstudenten angesprochen, der mich bereits in Luxor erspäht hatte. Wie sich schließlich herausstellt, studiert er in Amsterdam bei Manfred Woidich, einem alten Bekannten meiner Eltern, die arabische Sprache. Stunden stehen wir palavernd mitten im Souk, bis ich mich endlich losreiße, denn heute Nacht möchte ich noch fast bis zum Hafen am Hochdamm hinausfahren. Vergeblich ringe ich um Schlaf, die Aufregung angesichts der morgigen Einschiffung nach dem Sudan ist einfach zu groß. Im Morgengrauen falle ich doch noch in einen unruhigen Schlaf, aus dem ich hochschrecke, als die Sonne bereits am Himmel steht, und hastig packe ich meine Dinge zusammen.
Bei meiner Ankunft am Zoll stapeln sich bereits Berge von Kisten, Ballen, Koffern, Teppichen, Säcken, Matten und kunstvoll geschmückten Bündeln, zwischen denen geduldig abenteuerlich verkleidete Gestalten hocken, jede von ihnen eine eigene Beschreibung wert. Als Europäer habe ich mich nicht in dieses Gewimmel hinter der Absperrung zu stellen, so wird mir von dem Zollbeamten bedeutet, und ich bin ganz froh darüber, denn mit dem beladenen Rad wäre ich dort schlicht zur Bewegungslosigkeit verdammt. Auch an der Zollkontrolle winkt man mich unbehelligt durch, lediglich der Immigration-Officer rechnet offensichtlich mit der Schmierfreudigkeit europäischer Orientreisender. Er bedeutet mir mit finsterem Gesichtsausdruck, ich habe zu warten, doch aus seinen Reaktionen wird ersichtlich, daß hinter alledem keine Paßkontrolle, sondern eine Erwartung steht, und so bleibe ich ungerührt, naiv den Ahnungslosen vortäuschend, geduldig eine Viertelstunde, eine halbe Stunde penetrant freundlich direkt neben dem Schalter stehen, während ein beträchtlicher Strom von Sudanesen unbehelligt die Kontrolle passiert und mein Reisepaß unbearbeitet seiner Auslösung harrt. Der Beamte erkennt schließlich ganz richtig, daß mit mir nicht ins Geschäft zu kommen sei, stellt mir, als Vorwand für die Wartezeit noch eine fadenscheinige Frage zu meiner Registration und stempelt schließlich den Paß. Meine freundliche Danksagung und der Abschiedsgruß bleiben leider unbeantwortet.
|
Eine halbe Stunde vor (!) offizieller Abfahrtszeit lichten wir die Anker und fahren hinaus auf den Nasser- oder Nuba-Lake, der einem riesigen, unter Wasser gesetzten Sandkasten gleicht, aus dem die Spitzen einiger Sandburgen gerade noch hervorlugen, denn die umliegende Wüste taucht ohne jeden Pflanzensaum in den See ein. Gegen Abend wird die Stimmung noch surrealistischer. Es regt sich kein Windhauch, und die matt schimmernde Bleiplatte des Sees wird nur von unserem Wellenschlag verbogen, die fernen Erhebungen des dunklen Ufers wandeln sich zum schwarzen Oxydrand – welch stille Erhabenheit!
Dem völlig aufgelösten Hajji Said-en-Nur aus Khartoum helfe ich mit meiner Bestimmung der Qibla, der Gebetsrichtung nach Mekka, aus einer argen Patsche, denn die Bewegungen und Kursänderungen des Schiffes haben den Armen völlig die Orientierung verlieren lassen. Obwohl ich ungläubiger Europäer bin, traut er mir doch eine fachliche Kompetenz zu, denn flugs darauf verrichtet der ehrwürdige, weißbärtige Greis sein Maghrib-Gebet, das vierte des Tages.
Nach dem Sonnenuntergang ruft der Muezzin über die Bordlautsprecher die Gläubigen zum Abendgebet (Al Misal) aufs Oberdeck der in Hamburg auf Kiel gelegten "Sinai", und in zwei langen Reihen beugen sich die in weiße Burnusse gehüllten Nubier vor Allah-al Maujud, dem Allgegenwärtigen, wie einer der 99 im Koran erwähnten Namen Gottes lautet. Ein letzter Blick auf den vollen Mond, der über die Stille des Sees wacht, und glücklich vergrabe ich mich vor der vom Sternenhimmel niederfallenden Kälte in meinem Schlafsack.
Die frühe Morgensonne verleiht den Felsentempeln von Abu Simbel mit ihren harten Schatten ausgeprägte Plastizität. Besonders der Tempel Ramses' II. mit den Kolossalstatuen des Herrschers ist ein ungeheuerlicher Bau, vor dem sich die ersten Touristen wie Ameisen ausnehmen. Die deutsche Firma Hoch-Tief rettete in einer beispiellosen, von der UNESCO finanzierten Aktion den Tempel von Abu Simbel, indem sie die gewaltigen Steinmassen fein säuberlich zerschnitt, numerierte und oberhalb des zukünftigen Wasserspiegels des Stausees in zwei künstliche Berge wieder einfügte.
Je mehr wir uns nach Süden bewegen, desto lehmiger wird das Wasser, dessen Schwebstoffe sich auf der beruhigten Reise durch den Stausee nach und nach am Grund absetzen. In wenigen Stunden, so versichert mir Ahmed, mein neuer sudanesischer Freund aus Nyala, einer bedeutenden Stadt in der westlichsten Provinz des Sudan, werden wir in Wadi Halfa einlaufen – das afrikanische Abenteuer beginnt!!
Zum Seitenbeginn
Zum PapyrusArchiv
![]()
![]()